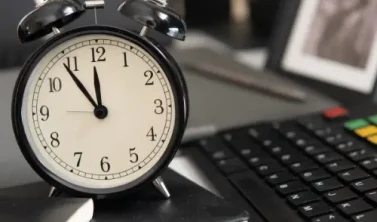Gesetzliche Grundlage: Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Seit 2013 ist durch eine Konkretisierung des Arbeitsschutzgesetzes eindeutig klargestellt: Die Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG muss ausdrücklich auch psychische Belastungen bei der Arbeit umfassen. Diese gesetzliche Verpflichtung richtet sich an alle Arbeitgeber – unabhängig von Branche oder Betriebsgröße. Dennoch zeigt die Praxis ein ernüchterndes Bild: Viele Unternehmen kommen dieser Pflicht nicht oder nur unzureichend nach.
Psychische Belastungen sind dabei nicht gleichzusetzen mit psychischen Erkrankungen. Der Begriff umfasst alle messbaren äußeren Faktoren, die auf den Menschen einwirken – etwa Arbeitsintensität, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen oder Arbeitsumgebung. Ob diese Belastungen zu einer Beanspruchung oder gar zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, hängt von individuellen Faktoren ab. Genau deshalb ist die systematische Erfassung und Bewertung so wichtig.
Die Gefährdungsbeurteilung dient der Prävention: Sie soll Risiken identifizieren, bevor Beschäftigte erkranken. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf Grundlage dieser Beurteilung konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu ergreifen. Hier liegt ein enormes Potenzial für den Betriebsrat, aktiv Einfluss zu nehmen und die Gesundheit der Belegschaft zu schützen.
Die starke Position des Betriebsrats: Mitbestimmungsrechte bei der Gefährdungsbeurteilung
Der Betriebsrat verfügt über weitreichende Rechte, wenn es um Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz geht. Diese ergeben sich aus mehreren Paragrafen des Betriebsverfassungsgesetzes:
§87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG – Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz: Der Betriebsrat hat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei Regelungen über den Gesundheitsschutz. Das bedeutet: Bei der Auswahl der Methode zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, bei der Festlegung der Bewertungskriterien und bei der Gestaltung von Maßnahmen muss der Arbeitgeber den Betriebsrat beteiligen. Ohne Einigung kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen.
§89 BetrVG – Arbeits- und Gesundheitsschutz: Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden. Er kann vom Arbeitgeber Maßnahmen verlangen und hat das Recht auf umfassende Information.
§80 Abs. 3 BetrVG – Betriebsbegehungen: Der Betriebsrat kann sich durch Betriebsbegehungen ein eigenes Bild von den Arbeitsbedingungen machen. Bei Verdacht auf psychische Belastungen kann er gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dem Betriebsarzt Gefährdungen aufdecken.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin stellt umfangreiche Handlungshilfen zur Verfügung, die Betriebsräte bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen.
Praktisches Vorgehen: Der Betriebsrat sollte zunächst prüfen, ob überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, kann er die Durchführung einfordern. Existiert eine Beurteilung, sollte er deren Qualität kritisch hinterfragen: Wurden alle relevanten Belastungsfaktoren erfasst? Wurden die Beschäftigten einbezogen? Wurden konkrete Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt?
Methoden der Gefährdungsbeurteilung: Von der Mitarbeiterbefragung bis zur Workshop-Analyse
Es gibt verschiedene wissenschaftlich fundierte Methoden zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Die Wahl der Methode sollte gemeinsam zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat erfolgen. Folgende Ansätze haben sich in der Praxis bewährt:
Standardisierte Mitarbeiterbefragungen: Mit validierten Fragebögen werden psychische Belastungen systematisch erfasst. Vorteile sind die schnelle Durchführbarkeit und die quantitative Auswertung. Der Betriebsrat sollte darauf achten, dass die Befragung anonym erfolgt, eine hohe Rücklaufquote erreicht wird und die Ergebnisse transparent kommuniziert werden.
Moderierte Workshops und Analysegespräche: In moderierten Gruppendiskussionen tauschen sich Beschäftigte über ihre Belastungen aus. Diese qualitative Methode ermöglicht tiefe Einblicke und fördert die Akzeptanz späterer Maßnahmen. Der Betriebsrat kann auf eine neutrale, externe Moderation dringen.
Beobachtungsinterviews und Arbeitsplatzbegehungen: Experten beobachten die Arbeitssituation direkt vor Ort und führen Gespräche mit Beschäftigten. Diese Methode eignet sich besonders bei spezifischen Problemlagen in einzelnen Bereichen.
Kennzahlenanalyse: Fehlzeiten, Fluktuation, Überstunden oder Krankheitstage können Hinweise auf psychische Belastungen geben. Der Betriebsrat hat nach §80 Abs. 2 BetrVG einen Anspruch auf Auskunft über diese Daten.
Wichtig ist: Die Methode muss zur Betriebsstruktur passen und die tatsächlichen Belastungen abbilden können. Der Betriebsrat sollte darauf bestehen, dass verschiedene Methoden kombiniert werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Praxisbeispiele: Wie Betriebsräte erfolgreich psychische Belastungen reduzieren
Beispiel 1 – Reduzierung von Arbeitsverdichtung im Produktionsbetrieb: In einem mittelständischen Produktionsunternehmen führte permanenter Zeitdruck zu massiven psychischen Belastungen. Die Gefährdungsbeurteilung, die der Betriebsrat durchgesetzt hatte, offenbarte: Die Taktvorgaben waren zu eng, Pausen wurden häufig durchgearbeitet, und die Krankheitsvertretung war unzureichend geregelt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse vereinbarte der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber konkrete Maßnahmen: Die Taktvorgaben wurden um 15 Prozent reduziert, eine verlässliche Springerregelung wurde eingeführt, und Pausenzeiten wurden konsequent eingehalten. Das Ergebnis: Die Fehlzeiten sanken innerhalb eines Jahres um 25 Prozent, die Mitarbeiterzufriedenheit stieg deutlich.
Beispiel 2 – Bessere Planbarkeit in der Pflege: In einer Pflegeeinrichtung führten kurzfristige Dienstplanänderungen und Unterbesetzung zu enormen Belastungen. Der Betriebsrat initiierte eine Mitarbeiterbefragung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Die Auswertung zeigte eindeutig: Die fehlende Planungssicherheit und der ständige Zeitdruck waren die Hauptbelastungsfaktoren. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wurde eine Betriebsvereinbarung erarbeitet, die verbindliche Mindestbesetzungen, eine Vorlaufzeit für Dienstplanänderungen und Entlastungstage nach besonders belastenden Schichten festlegte.
Beispiel 3 – Führungskultur als Belastungsfaktor: In einem Dienstleistungsunternehmen identifizierte die Gefährdungsbeurteilung das Führungsverhalten als zentrales Problem. Mitarbeiter berichteten von fehlender Wertschätzung, unklaren Zuständigkeiten und mangelnder Kommunikation. Der Betriebsrat nutzte sein Mitbestimmungsrecht und setzte durch, dass alle Führungskräfte an verpflichtenden Schulungen zu gesunder Führung teilnahmen. Zusätzlich wurde ein regelmäßiges Feedbacksystem implementiert, das konstruktive Kritik in beide Richtungen ermöglichte.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bietet umfassende Praxishilfen zur Umsetzung von Maßnahmen nach der Gefährdungsbeurteilung.
Wenn der Arbeitgeber sich weigert: Durchsetzungsstrategien für den Betriebsrat
Nicht immer zeigen sich Arbeitgeber kooperativ, wenn es um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen geht. Der Betriebsrat hat jedoch wirksame Instrumente zur Durchsetzung:
Initiativrecht nutzen: Der Betriebsrat kann nach §80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG vom Arbeitgeber die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung verlangen. Weigert sich dieser, kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen.
Einschaltung der Aufsichtsbehörde: Die zuständige Arbeitsschutzbehörde überwacht die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes. Der Betriebsrat kann sie über Verstöße informieren. Die Behörde kann dann Anordnungen erlassen und im Extremfall Bußgelder verhängen.
Öffentlichkeit herstellen: In besonders hartnäckigen Fällen kann der Betriebsrat auch die Belegschaft informieren und auf diese Weise Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Eine transparente Kommunikation über das Thema psychische Belastungen sensibilisiert die Beschäftigten und stärkt die Position des Betriebsrats.
Fazit: Prävention statt Reaktion – die Gefährdungsbeurteilung als Instrument der Zukunft
Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist weit mehr als eine lästige Pflichtübung. Sie ist ein strategisches Instrument des Betriebsrats, um nachhaltig gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten langfristig zu erhalten. In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und steigender Krankenstände ist präventives Handeln entscheidend. Der Betriebsrat, der seine Mitbestimmungsrechte konsequent nutzt, kann nicht nur Einzelfälle verhindern, sondern eine ganze Unternehmenskultur verändern. Die Gefährdungsbeurteilung ist damit tatsächlich das schärfste Schwert im Arbeitsschutz – vorausgesetzt, der Betriebsrat weiß es zu führen.

Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden Ihre Antwort!