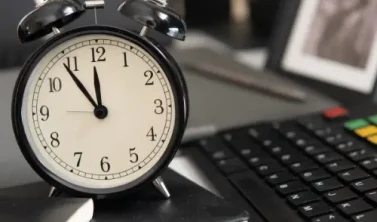Bereitschaftsdienste gibt es nicht nur bei Polizei und Feuerwehr, sondern auch in vielen weiteren Berufsgruppen. Egal, was der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt tut, meldet sich der Arbeitgeber, geht es sofort auf die Arbeit. Wir schauen uns an, welche Regelungen es zur Vergütung von Bereitschaftsdiensten gibt, welche Rolle der Betriebsrat spielt und welche Bereitschaftsschichten zumutbar sind.
Was genau ist der Bereitschaftsdienst?
Beim Bereitschaftsdienst muss sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten, um bei Bedarf sofort die Arbeit aufnehmen zu können. In einigen Fällen liegt dieser Ort innerhalb des Betriebsgebäudes, beispielsweise bei Beamten der Feuerwehr. Nach individueller Absprache kann sich der Arbeitnehmer jedoch an einem anderen Ort aufhalten, von welchem er rechtzeitig an der Arbeitsstelle ankommt.
Meist findet eine Vereinbarung Anwendung, welche regelt, in welchem Zeitfenster der Arbeitnehmer am Einsatzort / der Arbeitsstelle sein muss, wenn seine Arbeitskraft benötigt wird. Bereitschaftsdienste können grundsätzlich nicht während der Urlaubszeit geleistet werden, der Arbeitnehmer verpflichtet sich zudem, während des Bereitschaftsdienstes arbeitsfähig zu sein. Alkohol und Drogen sind deshalb tabu.
Wichtig: Der Bereitschaftsdienst ist abzugrenzen von der Arbeits- und Rufbereitschaft. Bei der Arbeitsbereitschaft handelt es sich um einen wachen Zustand der Entspannung während der Arbeitszeit, in der Rufbereitschaft kann der Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort selbst bestimmen.
Wann und wie lange ist Bereitschaftsdienst möglich?
Der Bereitschaftsdienst ist grundsätzlich nicht an bestimmte Arten von Unternehmen oder Berufsgruppen gebunden. Aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2000 und der darauffolgenden Anpassung im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gilt die gesamte Dauer der Bereitschaftszeit als reguläre Arbeitszeit. Demnach müssen alle Regelungen zu Höchstarbeits- und Pausenzeiten nach dem ArbZG eingehalten werden.
Die maximale tägliche Arbeits- und Bereitschaftszeit liegt demnach bei acht Stunden, in der Woche sind es 48 Stunden. Nach § 3 ArbZG darf die Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden verlängert werden, wenn ein Zeitausgleich stattfindet. Bedeutet: Innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten darf die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit nicht mehr als acht Stunden betragen.
Wird über einen längeren Zeitraum und in erheblichem Umfang (= mehr Bereitschaftszeit als reguläre Arbeitszeit) Bereitschaftsdienst geleistet, kann dies zwischen beiden Parteien vertraglich vereinbart werden. Wichtig ist jedoch, dass sich in regelmäßigen Abständen Bereitschaftsdienst und normale Arbeitszeit abwechseln müssen, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten.
Wichtig: Da die Bereitschaftszeit als reguläre Arbeitszeit gilt, wird diese auch im vertraglich vereinbarten Umfang bezahlt. Es gibt keine Sonderregelungen oder Gehaltskürzungen während des Bereitschaftsdienstes (§ 3 ArbZG).
Die Rolle des Betriebsrats bei Bereitschaftsdiensten
Bei der Ausgestaltung aller Regelungen zum Bereitschaftsdienst hat der Betriebsrat ein Mitspracherecht. Dieses ergibt aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, welcher besagt, dass der Betriebsrat immer dann mitbestimmen darf, wenn eine Regelung direkt die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden betrifft.
Der Betriebsrat sorgt demnach dafür, dass die Interessen der Beschäftigten durchgesetzt und rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Zudem fungiert er bei Anregungen und Beschwerden als Bindeglied zwischen Belegschaft und Unternehmensführung. Um die Sicherheit aller Mitarbeitenden zu gewährleisten, sollte der Betriebsrat zudem in regelmäßigen Abständen prüfen, ob geltende Regelungen rund und Arbeits- und Pausenzeiten eingehalten werden.

Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden Ihre Antwort!